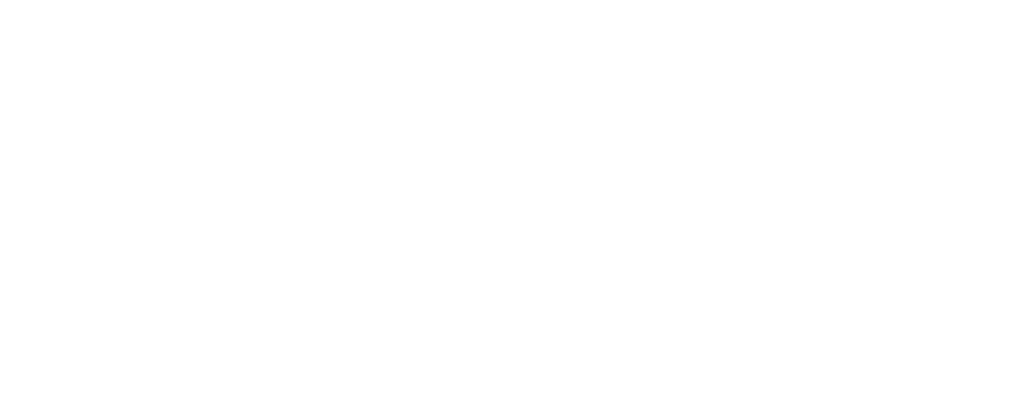Viele der 370 Millionen wahlberechtigten Bürger der Europäischen Union haben kürzlich an den Wahlurnen das Europäische Parlament gewählt. Das gesetzgebende Organ der EU ist für alle Bereiche zuständig, von der Änderung von Gesetzen bis zur Ernennung einer Exekutive in Brüssel. Alle 720 Sitze stehen zur Wiederwahl.
Obwohl Deutschland, Frankreich und Italien die größten Bevölkerungsgruppen stellen, basieren die Loyalitäten im Parlament weniger auf nationaler als auf ideologischer Zugehörigkeit. Politische Parteien aus allen 27 Mitgliedsstaaten bilden Fraktionen oder Caucuses, die ihnen dabei helfen, Gesetze im Einklang mit ihren Wahlprogrammen zu verabschieden.
Die Wahl zeigt eine Verschiebung der Prioritäten Europas. 2019 lag der Fokus vor allem auf Umweltschutz und sozialer Gerechtigkeit. Seitdem haben die Wähler zunehmend Parteien unterstützt, die sich für industrielle Entwicklung und weniger Regulierung stark machen. Insgesamt haben Mitte-Rechts- und rechtsnationalistische Bewegungen Zugewinne erzielt. In Frankreich und den Niederlanden sind diese Bewegungen stärker denn je und tadeln damit die Politik der EU in den letzten fünf Jahren.
Keine Wahl kann in ihrem Ergebnis einem bestimmten Ereignis zugeordnet werden. Seit der letzten Wahl hat Europa mit den Auswirkungen von Covid-19, der anhaltenden Inflation, Energieknappheit und dem Krieg in der Ukraine zu kämpfen. Migrationsfragen stehen weiterhin ganz oben auf der Tagesordnung. Allerdings haben die Bauernproteste der letzten zwei Jahre das Vertrauen in die EU-Institutionen untergraben.
In Belgien, den Niederlanden, Frankreich und Deutschland protestierten Landwirte gegen Umweltschutzbestimmungen. Sie drückten ihre Frustration darüber aus, dass ihre Betriebe zwar für das Wohl der Verbraucher unverzichtbar sind, der Regulierungsstaat dies jedoch zunehmend unmöglich macht. Auch andere Umweltschutzmaßnahmen – wie das geplante Verbot von Verbrennungsmotoren, Ökosteuern oder das Verbot von Einweg-Küchenutensilien aus Plastik – berührten die Verbraucher. Die Proteste der Landwirte machten das Thema für die Wähler greifbarer.
Auch wenn sich die Landwirtschaft im Laufe der Zeit verändert hat, hatte sie doch immer eine besondere Verbindung zu den Verbrauchern. Die Regierungsbürokratien dagegen schienen immer distanziert, ob sie die Bauern im Feudalsystem arm hielten oder in den modernen Formen der Landwirtschaft, in denen jede Nische überreguliert und auf einen politischen Trend abgestimmt ist. Seit 2019 wird in Europa die Landwirtschaft für das Versagen des Kontinents bei der Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen verantwortlich gemacht.
Ironischerweise hätten die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht viel zur Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit der Landwirtschaft beigetragen; im Gegenteil, sie haben den Sektor in den Bankrott getrieben. Ein inzwischen fallengelassener Vorschlag, den Pestizideinsatz um 50 Prozent zu reduzieren, hätte es den europäischen Landwirten beispielsweise noch schwerer gemacht, auf pfluglose Landwirtschaft umzusteigen, die die Bodenerosion verringert und den Ausstoß von mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre verhindert. Die EU-Institutionen waren von Pestizidgegnern vereinnahmt worden, die diese Produkte aus ideologischen Gründen ablehnen – auf Kosten wissenschaftlicher Argumente, des Verbraucherwohls und der Existenzgrundlage der Landwirte.
Die Wähler in Europa haben den Politikern eine klare Botschaft übermittelt: Es gibt vernünftige Möglichkeiten, die Umwelt, in der wir leben, zu schützen und zu verbessern, aber groß angelegte Eingriffe ohne Bedürftigkeitsprüfung werden den Menschen schaden, die uns ernähren. Aus diesem Grund werden die neuen Gesetzgeber auch motiviert sein, viele der bürokratischen Netze zu entwirren, die die EU in ihrer vorherigen Amtszeit gesponnen hat.
In Europa hat sich der Trend zum radikalen Umweltschutz gewendet, und das ist für uns alle ein Vorteil.
Ursprünglich veröffentlicht hier